Auszüge aus dem Buch Schach in Württemberg von Eberhard Herter. Das Buch ist auch mit freundlicher Genehmigung des Verlags und des Autors zum Download verfügbar.
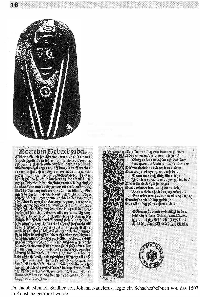
Der Tübinger Springer
Auch die frühe Schachliteratur ist eng mit Tübingen verknüpft. So hat der Ver- fasser des ersten gedruckten Schachbuchs in deutscher Sprache, der sich vor hat, allem als Genealoge Kaiser Maximilians 1. einen Namen gemacht in Tübingen studiert. Es handelt sich um den vermutlich aus Bregenz stammenden Dr. Jacob Mennel (1460 - 1526), der sich während seiner Tübirrger Zeit von 1477 - 1484 hauptsächlich mit der Philosophie bei dem damals hochberühmten Ge- lehrten Johann Nauclerus befaßt hat. Daneben muss Mennel aber auch mit Leidenschaft das Schachspiel betrieben haben. Als er erfahren hatte, dass Maximi- lian I. „ ... zur Erholung seines von Sorgen bedrückten Geistes Schach spiele ... ", übersandte er ihm im Jahre 1498 eine Abhandlung über die Frage, ob das Schachspiel nach kirchlichem und bürgerlichem Rechte erlaubt sei, wobei er darauf hinwies, dass das Schachspiel kein Zufall oder Glücksspiel sei, sondern allein vom menschlichen Intellekt beherrscht, also anerkennenswert sei. Vor allem aber verfaßte Mennel das 590 Zeilen umfassende und im Jahre 1507 in Konstanz bei Hans Schäffeler gedruckte sog. Schachzabelbuch, dessen Grund- lage eine Bearbeitung der berühmten Schachpredigt des Dominikanerpaters Jacobus de Cessolis aus dem Hochmittelalter durch den Schweizer Konrad von Ammenhausen war. Frühere Schachhistoriker haben den Vorwurf erhoben, das Schachzabelbuch Mennels sei, da kritiklos aus Vorveröffentlichungen über- nommen, letztlich nur ein Plagiat. Demgegenüber hat Petzold jüngst überzeu- gend nachgewiesen, dass dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt ist, da Mennel die von ihm gefundenen und verwerteten Dokumente sehr wohl interpretiert hat und zu gewichten wußte. Obwohl das Schachzabelbuch noch ganz im alten Stil, also mit der kurzschrittigen, nur diagonal ziehenden Königin und den schwachen, schräg springenden Vorgängern der heutigen Läufer geschrieben war, fand es in der Folgezeit wie seine verschiedenen Nachdrucke zeigen, offenkundigen An- klang. Der „Tübinger" Jacob Mennel, seiner beiden Doktorentitel wegen allge- mein der Doktor Mennel genannt, kann deshalb als wichtiger Schachbuchver- fasser am Ausgang des Mittelalters bezeichnet werden. Einhundert Jahre später, im Jahre 1616, erschien in Leipzig unter dem Pseudo- nym „Gustavus Selenus" ein umfangreiches deutschsprachiges Schachbuch unter dem Titel „Schach- oder König -Spiel", das i m Deutschland des beginnen- den 17. Jahrhunderts keine vergleichbaren Vorgänger hatte. Verfasser dieses nach jahrelangen Vorbereitungen unter Verwendung aller zugänglichen Quellen herausgegebenen Schachbuchs war kein geringerer als Herzog August zu Braunschweig und Lüneburg (1579-1666), ein vielseitiger, bedeutender und berühmter Sammler, Fürst und Gelehrter, der auch einige Jahre seines Lebens in Tübingen verbracht hat. Das Interesse Herzog Augusts am Schachspiel reicht weit in seine Jugend zurück. Auf seinen Bildungsreisen beschrieb er als Inven- tar fürstlicher oder königlicher Kunstkammern wiederholt auffallende Schach- bretter oder -figuren, von denen er auch selbst welche besaß. Es liegt daher auf der Hand, dass der Herzog auch während seiner Tübinger Studienjahre (1595 - 1598) das Schachspiel nie vernachlässigt hat. Frühe Kupferstiche von ihm als Schachspieler, nach denen das berühmte Portrait von ihm beim Schachspiel auf S. 216/217 des „Selenus" gestochen sein dürfte, und seine eigene Aussage in einem Brief an Kaiser Ferdinand II. aus dem Jahre 1624 sprechen jedoch für sich: „Ich habe in meinem otio, das mir der Allmechtige uber mein sortem bescheret, gleichwol so ocios nicht seyn wollen, dass ich etliche Zeiten, nicht hin wieder den humanioribus tribuiret". Kleine Auszüge aus Herzog Augusts seltenem und dennoch alsbald berühmt gewordenem Schachbuch, in dem erst- mals in deutscher Sprache nicht nur mit großer Ausführlichkeit über die Ge- schichte und Gesetze, sondern auch über die Praxis des Schachspiels berichtet wird, wurden im 17. und 1 8. Jahrhundert mit zumeist glorifizierenden Vorreden an Gustavus Selenus oft gedruckt. Sie zeigen auf, welch großen Einfluß Herzog August, der zeitweilig auch Ehrenrektor der Tübinger Universität war, mit sei- nem verdienstvollen Werk auf die Verbreitung des Schachspiels in der Folgezeit ausübte. Für die folgenden Jahrhunderte liegen uns keine schriftlichen Zeugnisse über das Schachspiel in Tübingen vor. Gleichwohl dürfte es sich dort in Adelskrei- sen, fosbesondere in dem in einer Art Ritterakademie ausgebauten Collegium Illustre, in der gehobenen Bürgerschicht und in akademisch studentischen Krei- sen nach wie vor großer Beliebtheit erfreut haben. Als sich im 19. Jahrhundert die Schachspieler in Deutschland mehr und mehr organisierten, ging diese Welle auch nicht an Tübingen vorbei. Am 6. Mai 1 870 wurde der „Akademische Schachverein Tübingen" gegründet, der sich einer- seits kaum von den anderen Burschenschaften unterschied, andererseits aber auch in der „Restauration zum Hades" dem Schachspiel huldigte, dotierte Schachturniere austrug, Übungsabende abhielt und „Korrespondenzpartien" mit anderen akademischen Schachvereinen in Berlin, München und Gießen veran- staltete. Obwohl der Verein wenige Jahre später dem 1 877 gegründeten Allge- meinen Deutschen Schachbund beitrat, pflegten die Studenten in der Folgezeit das königliche Spiel in erster Linie unter sich, bis sich der Verein nach dem Ersten Weltkrieg, nunmehr als „Schachverein Tübingen" firmierend, der Tübin- ger Bürgerschaft öffnete und ab diesem Zeitpunkt allen Bevölkerungsschichten zugänglich war. Tübinger Beiträge zum Thema Schach In dieser von Dr. Hans Ellinger herausgegebenen Buchreihe sind bis jetzt die in [108] aufgeführten fünf Bände erschienen. (Auszug aus dem Buch von Eberhard Herter)
